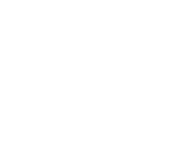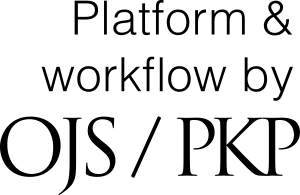Leseunterricht und seine Orientierungen nach der PISA-Studie. Konzeptionen und Praktiken im Spannungsfeld von alltagsbezogener Kompetenzorientierung und Enkulturation
DOI:
https://doi.org/10.24452/sjer.32.3.4843Schlagwörter:
Lesekompetenz, Leseunterricht, Leseförderung, Leseleistung, Leistungsdiagnose, LiteraturwerbAbstract
In der Folge von PISA lässt sich eine zunehmende Orientierung an einer Vorstellung von Lesekompetenz beobachten, die Lesen auf messbare Teilkompetenzen herunterbricht. Diese Vorstellung gründet in einem kognitionstheoretischen Modell des Leseprozesses, wobei Lesen als soziale Handlungsfähigkeit konzeptualisiert und auf alltägliche Anwendungssituationen bezogen wird. So einleuchtend diese Vorstellung insbesondere auch für eine vergleichende Leistungsmessung ist, so ist sie doch für den heutigen Leseunterricht problematisch. Zum einen blendet sie die unter der Erwerbsperspektive wichtigen emotionalen und motivationalen Aspekte des Lesens aus, und zum anderen steht sie unvermittelt Bildungstraditionen gegenüber, welche dem literarischen Lesen Bedeutung beimessen. Die Leseforschung gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass der Leseunterricht auf der Sekundarstufe I als Zusammenspiel von Lesetraining, Leseförderung und literarischem Lesen gestaltet werden soll, wobei die Schulpraxis auf verlässliche Aussagen zur jeweiligen Wirksamkeit angewiesen ist.
Downloads
Downloads
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International.